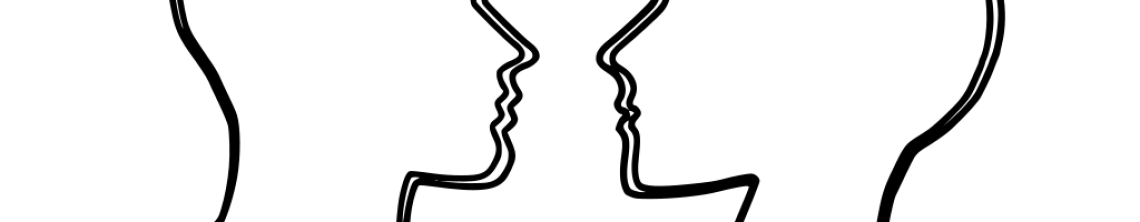Von Katharina Nowak und Katharina Amann
„Die Idee der Stadt Wien ist, die Leitdifferenz Geschlecht aufzulösen. Das Individuum verhält sich so wie es will, egal ob Mann oder Frau.“
Eva Reznicek

Eva Reznicek arbeitet seit 35 für die Stadt Wien. Nach ihrem Psychologie Studium hat sie für die Stadt Wien in der Kinder- und Jugenhilfe gearbeitet, später in der Magistratsdirektion im Bereich Organisation. Dabei war sie bei der Einführung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten in den Magistratsabteilungen, welche im Rahmen des New Public Management erfolgte, beteiligt. Derzeit ist sie Fachbereichsleiterin der internen Organisation und Strategie für die Stadt Wien – Kindergärten und freiberuflich systemische Familientherapeutin. Sie beschreibt ihren Beruf als Management Job.
Stadt Wien – Kindergärten
Die Stadt Wien – Kindergärten sorgt für die Organisation der elementaren Bildung in Wien durch das Führen städtischer Kindergärten und die Förderung privatrechtlich organisierter Einrichtungen. Die Stadt Wien – Kindergärten ist die größte Magistratsabteilung der Stadt mit über 8000 MitarbeiterInnen. Die meisten davon sind in den rund 350 städtischen Kindergärten als PädagogInnen und AssistentInnen beschäftigt. Die städtischen Kindergärten bilden ca. 35% des Gesamtangebots an Kindergärten in Wien. Die restlichen 65% werden von privaten Trägern organisiert und von der Stadt Wien gefördert.
Der Fachbereich Interne Organisation plant die Ausbaustrategie des Kindergarten-Angebots. Sie plant wo, wann, welche Kinder Kindergartenplätze brauchen. Zusammen mit der Behörde wird auch die Qualität in den Kindergärten sichergestellt. Alle Kindergärten (private und städtische) werden von der Aufsichtsbehörde für Kindergärten kontrolliert, welche in der MA11 Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt ist.
Außerdem zählt zu den Aufgaben der Stadt Wien – Kindergärten die vom Bund übertragenen Aufgaben umzusetzen, wie zum Beispiel die sprachliche Bildung und Deutschförderung zu organisieren.
Weiters liegt die Führung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der externen und internen Unternehmenskommunikation, die interne Revision, Controlling, und die Rechtsabteilung im Organisationsbereich von Eva Reznicek.
Unterstützung der Stadt Wien Kindergärten bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auf die Frage wie alleinerziehende Frauen und Männer mit Kindern im Kindergartenalter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie von der Stadt Wien unterstützt werden, antwortete uns Eva Reznicek: „Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir Kindergärtenplätze für Kinder von null bis sechs zur Verfügung stellen und diese grundsätzlich beitragsfrei sind.“ Für Essen und sonstige Zusatzleistungen entstehen Kosten, allerdings bezahlen Eltern durch die Förderung der Stadt keinen Beitrag für den Kindergarten selber, wodurch sie sich einige tausend Euro pro Jahr sparen.
„Auch die Öffnungszeiten der Kindergärten sind auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgerichtet. Grundsätzlich sind diese von 6:30 bis 17:30 Uhr bzw. von 6:00 bis 18:00 Uhr.“ ergänzt Reznicek. Abweichende Vereinbarungen können im jeweiligen Kindergarten nach Bedarf getroffen werden. Eva Reznicek verwies dabei auf die VIF (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf) Kriterien, in welchen Regelungen, unter anderem bezüglich der Öffnungszeiten vorgeschrieben sind. (Mind. 45 Stunden/Woche geöffnet, Werktags, von Montag bis Freitag geöffnet, an vier Tagen mind. 9,5 Stunden geöffnet). Diese Kriterien müssen erfüllt werden, damit die Stadt Wien einen Kindergarten fördert.
Geschlechterverteilung

Zur Geschlechterverteilung konnte uns Eva Reznicek genaue Auskunft in den städtischen Kindergärten geben:
- Pädagoginnen: 96 %
- Pädagogen: 4 %
- Assistentinnen (Muss volljährig sein, aber keine besondere Qualifikation haben. Werden angelernt): 99%
- Assistenten: 1%
- Assistenz Pädagoginnen (dreijährige Ausbildung in Kolleg): 90 %
- Assistenz Pädagogen: 10 %
Interessant dabei ist, dass der Bereich der Assistenz Pädagogen noch nicht sehr groß ist, aber setig wächst. Im Vergleich zur Geschlechterverteilung in der BAfEP für die 14 bis 19-Jährigen (Bundesanstalt für Elementarpädagogik, bundesweit organisiert) sind im Kolleg, wo Erwachsene, die bereits Matura haben und meist BerufsumsteigerInnen sind, zu ElementarpädagogInnen usgebildet werden mehr Männer (18%). Grund dafür ist, dass sich viele Männer erst mit höherem Alter dazu entscheiden in diesen Beruf einzusteigen, während Burschen im Alter von 14 Jahren, wenn sie in eine höhere Schule wechseln noch nicht wissen was sie wollen und stärker von diesem Klischee des Frauenberufs beeinflusst sind. Außerdem erläutert Eva Reznicek weiter: „Durch die Kolleg Form wird gefördert, dass die Zahl der Kindergartenpädagogen steigt, da Männer, die das Kolleg besuchen mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in dem Beruf bleiben.“
Leider bleiben die Bundesländer tendenziell eher bei der fünfjährigen BAfEP mit Matura und bauen weniger die Kollegs aus, obwohl dies eigentlich das effizientere Modell wäre.
Es gibt auch Zivildiener, welche in den Kindergärten arbeiten.
Einfluss der Pädagogen auf die Kinder
Bezüglich der Frage, welchen Einfluss männliche Kindergartenpädagogen auf die Kinder haben, erklärt uns Eva Reznicek:
„Die Idee bei uns ist, dass wenn es ideal läuft, wir einen Raum schaffen möchten, wo Kinder Männer und Frauen in unterschiedlichen Rollen erleben können, die nicht so stark von üblichen Klischees gekennzeichnet sind.“
Gerade wenn Kinder von Zuhause die Vorstellung von Männern und Frauen in den typischen Klischee Rollen mitbringen, sollen sie im Kindergarten Männer in Rollen wahrnehmen, in denen sie Männer vielleicht sonst eher nicht so sehen. (PädagogInnen die mit ihnen spielen, die Kinder trösten, ein Servierwagerl herumschieben). Das Kindergartenteam muss dabei aufpassen, dass sie bestehende Klischees nicht fortsetzen. Die Angebotsetzung soll von männlichen und weiblichen PädagogInnen gleich sein und ist nach Ergebnissen der Forschung auch in der Praxis sehr ähnlich.
„Die Idee der Stadt Wien ist, die Leitdifferenz Geschlecht aufzulösen. Das Individuum verhält sich so wie es will, egal ob Mann oder Frau.“
Es werden, wenn möglich mehrere Männer an einem Standort eingesetzt, sie sollen nicht vereinzelt auf die Kindergärten aufgeteilt sein. Es gibt auch Qualitätszirkel, in denen die männlichen Pädagogen miteinander über ihre Rolle sprechen und sich austauschen können.
Gehalt
Im weitesten Sinne findet Eva Reznicek die Gehälter der PädagogInnen angemessen, betont aber, dass das Gehalt im Vergleich mit anderen Berufsgruppen wie z.B. Bauingenieuren auch höher sein könnte, da im Kindergarten Grundsteine für weitere Bildungswege gelegt werden und von den PädagogInnen eine intellektuelle Kapazität erwartet wird, welche sich in der Bezahlung noch nicht widerspiegelt.
Im Magistrat ist es so, dass andere vergleichbar Ausgebildete weniger verdienen. Das Gehalt wurde in der letzten Zeit sukzessive angehoben. Eine weitere Erhöhung ist momentan nicht angedacht. Es gibt allerdings verschiedene Gehaltsstufen, je länger man für die Stadt Wien Kindergärten arbeitet. Gehaltsunterschiede von Männern und Frauen gibt es im gesamten Magistrat nicht.
Ausbildung und Weiterbildung der KindergartenpädagogInnen
Unter den Leitbildern der städtischen Kindergärten findet sich auch die Aussage „Wir haben verlässliche Rahmenbedingungen und Strukturen. Grundlage für unsere tägliche pädagogische Bildungsarbeit sind der Wiener Bildungsplan, sowie die Qualitätsstandards der Stadt Wien – Kindergärten.“
Eva Reznicek erklärt uns: „Die Qualitätsstandards sind Leitsätze zu bestimmten Themen, wie z.B. sprachliche Bildung, Bewegung, Essen als zentrale pädagogische Handlung, Umgang mit Ethik und Religion.“ Diese Leitsätze stehen auch für Eltern zur Verfügung, hängen im Kindergarten aus und sind im Internet zu finden.
Daneben gibt es auch einen bundesweiten Bildungsplan, welcher dem Wiener Bildungsplan ähnlich ist. Er beschreibt Besonderheiten der Elementarpädagogik und den Unterschied zu anderer Pädagogik. Es geht dabei um den Zugang zum kompetenten Kind, bei dem die Fragen: Was braucht es? Was kann es? Was interessiert es? Im Mittelpunkt stehen. Der Bildungsprozess wird mit dem Kind gemeinsam entwickelt.
Eva Reznicek führt weiter aus und gibt uns ein Beispiel dazu: „Je mehr man in einem Kindergarten feststellen kann, dass die Kinder nicht alle das Gleiche machen, desto reformierter und moderner ist der pädagogische Zugang. Es geht darum, dass die Kinder entscheiden, wann sie was machen. Der Übergang vom Spielen zum Essen beispielsweise soll mit den Kindern gesteuert werden. Das bedeutet, dass sie zuerst mit der Sache fertig werden, die sie gerade machen und sich dann selber entscheiden essen zu gehen. Gerade mit ganz jungen Kindern ist das ein sehr dichtes interaktives Geschehen.“
Weiterbildung
Die Stadt Wien bietet den Kindergarten-PädagogInnen die Möglichkeit der ständigen Weiterbildung. Zur Auswahl stehen u.a. Schulungen im Bereich Diversität, Management und pädagogisches Fachwissen sowie diverse Kurse zur richtigen Gesprächsführung. Die Fortbildungen finden entweder in externen Räumlichkeiten in Form von Workshops statt, zu denen sich die PädagogInnen anmelden können oder direkt am Standort des Kindergartens. Bei zweiterer Variante werden vorwiegend Themen, die mit genderbezogenen Aspekten und Diversität zu tun haben, behandelt.
Eva Reznicek klärt uns auf: „Diese Art von Schulung passt sich an den Standort und an das Angebot des jeweiligen Kindergartens an und versucht, die Teams der Standorte weiter zu entwickeln.“ Darüber hinaus erfuhren wir, dass das Bildungsangebot der Kindergärten der Stadt Wien in erster Linie die Haltung und den Zugang zum Kind, die Methoden sowie die Bildungsbereiche, welche die Stadt Wien abdecken möchte, behandelt. Es gibt keine konkrete Anweisung, wie das Bildungsangebot gestaltet werden soll, die Herangehensweisen werden geplant, oft in jeder Situation überlegt und individuell angepasst und regelmäßig reflektiert.
Bisher standen pädagogische Schwerpunktthemen im Fokus: erst letztes Jahr stand das Thema „Gendersensible Pädagogik“ im Mittelpunkt. Darüber hinaus wünscht und forciert die Stadt Wien den ständigen Austausch zwischen den verschiedenen Standorten. Leitungen unterschiedlicher Kindergärten werden dazu angehalten, sich zu verknüpfen und gegebenenfalls neue Ideen zu übernehmen. Es steht den PädagogInnen frei, in welchem Gebiet sie sich weiterentwickeln möchten, sie sind lediglich dazu verpflichtet, sich nach der gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststundenanzahl zu richten. Grundsätzlich herrscht Methodenfreiheit. Eva Reznicek sieht das grundlegende Problem in der Kapazität der angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten: die Stadt Wien – Kindergärten müsste die Schulungsangebote ständig erweitern, um der großen Anzahl von PädagogInnen und AssistentInnen gerecht zu werden. Konkret bei der Gruppe der AssistentInnen ist noch ein Vielfaches an Haltungsarbeit erforderlich, da das Personal oftmals aus sehr unterschiedlichen Kontexten stammt.
Gewaltprävention für Mädchen und Buben

In Kindergärten der Stadt Wien wird auch Gewaltprävention zum Thema gemacht. Eva Reznicek betont, dass tendenziell situationsorientiert gearbeitet wird, was bedeutet, dass zum Beispiel jede entstehende Konflikt-Situation, gezielt behandelt wird. Einerseits wird beobachtet, inwieweit das Betreuungspersonal im Bildungskontext Gewalt ausübt (es liegt bereits Gewalt vor, wenn eine Pädagogin/ein Pädagoge ein Kind kräftig am Arm anfasst), andererseits wird darauf geachtet, ob Kinder zuhause Gewalt ausgesetzt sind. Bei zweiterem Szenario ist unverzüglich und verpflichtend die Jugendhilfe einzuschalten. Sollten Kinder untereinander in Konflikt geraten, ist es wichtig, dass die PädagogInnen dies im Alltag behandeln. Hierfür gibt es kein konkretes Programm, aber unterstützende Materialien. Es wird viel Kompetenz vom Personal erwartet – betreuend, schlichtend, und reflektierend einzugreifen. Im Hort werden vermehrt Angebote zum Umgang mit Konflikten zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise das Programm „faustlos“. Hier geht es darum, zu lernen, wie ohne Gewalt anzuwenden, ein Konflikt gelöst werden kann. Bei allen gewaltpräventiven Maßnahmen werden laut Frau Reznicek Burschen und Mädchen gleichermaßen angesprochen.
Diversität
Die Stadt Wien schreibt in ihrem Text zum Thema „Diversität“, dass die gesellschaftliche Geschlechterrollenzuteilung Kinder in ihrem Tun und ihrer Individualität einschränkt. Aus diesem Grund wird zunächst in Kindergärten der Stadt Wien darauf geachtet, Mikrodifferenzierungen zu unterlassen.
Ausstattung

Eva Reznicek erklärt: „Im Kindergarten ist es so, dass sich nicht mehr alles in einem Raum abspielt – es gibt nicht mehr in jeder Gruppe eine klassische Bau- und Puppenecke – heute ist es so, dass sich das Geschehen im ganzen Gebäude, auch am Gang oder in sogenannten Multifunktionsräumen abspielt.“ In einer Gruppe kann der Fokus beispielsweise auf Bau und Konstruktion gelegt werden, in einer anderen auf Familie und Soziales. Die Angebote werden auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Die Idee dahinter ist, dass die Einrichtungsgegenstände und Utensilien relativ leicht verstellbar und universell verwendbar sind. Laut Frau Reznicek kann ein mobiler Wagen beispielsweise zum Kaufmannsladen, zu einer Werkstatt oder einem Theater transformiert werden, da die Stadt Wien versucht, möglichst multifunktional auszustatten. Selbstverständlich sind fertige Kinderküchen noch vorhanden, diese werden jedoch in Zukunft zusehends weniger angeschafft, da der Fokus, wie bereits erwähnt, darauf gelegt wird, möglichst wenig vorzugeben. Denn, so Eva Reznicek, „je weniger fix vorgegeben wird, desto kreativer werden die Kinder und umso mehr lernen sie.“
Ein weiterer Punkt, der die Ausstattung der Kindergärten der Stadt Wien betrifft, sind die Toiletten: Laut Angaben von Frau Reznicek sind diese geschlechtsneutral – sprich die Buben und Mädchentoiletten sind nicht getrennt.
Das gesamte Spielzeugangebot der Kindergärten der Stadt Wien ist ein äußerst Großes und beinhaltet unter anderem diverse Brett- und Gesellschaftsspiele, Bewegungsgegenstände, Mal- und Gestaltungsmaterial, sowie Bau- und Konstruktionsmaterialien. Auch hier gilt: Die Spielsachen werden auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten eingekauft.
Chancengleichheit
Auch auf Chancenausgleich und die Zukunft der Kinder wird seitens der Stadt Wien größten Wert gelegt. Es gibt zwar nicht für alle Kinder in jeder Altersstufe ausreichend Plätze (für die unter 3-jährigen gibt es derzeit einen Versorgungsgrad von 45%; Erst bei den 3 bis 6-jährigen werden 100% erreicht). Fest steht, dass Kinder in jedem Alter, jeder Herkunft und jeder Kompetenzfähigkeit aufgenommen werden. Abschließend betont Frau Reznicek: “Es geht um den sozioökonomischen Hintergrund der Kinder, weshalb verstärkt versucht werden soll, die Ressourcen ganz besonders in jene Standorte zu investieren, wo der sozioökonomische Hintergrund der Kinder nicht viel bieten kann. Ziel ist es, die Situation der benachteiligten Kinder auszugleichen!“