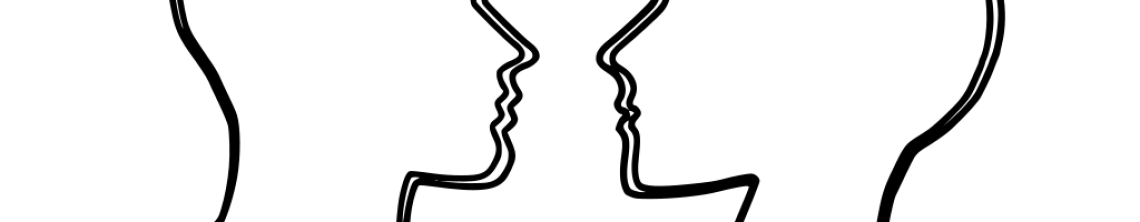Von Isabella Eckerstorfer
How do you tell women’s stories? Ask women to tell them. Mit diesen Worten betitelte die Journalistin Megan Kamerick einen TED Talk zur Unterrepräsentation von Journalistinnen in den USA. Doch wie viele Frauen in Österreich erzählen die relevanten Geschichten? Wie viele recherchieren, interviewen und berichten über jene Themen, die unsere Gesellschaft bewegen?
Bisher war die Antwort der Forschung: zu wenige. Repräsentative Umfragen schätzen die Zahl der Journalistinnen in Österreich zwischen 39 und 42 Prozent, trotzdem fehlte bis dato eine umfassende Datengrundlage, die konkrete Zahlen zu Medienmacherinnen liefert. Gerade in Österreich, dessen Medienlandschaft hoch konzentriert und durch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk geprägt ist, ist die Bandbreite an unterschiedlichen Perspektiven in den Medien oft überschaubar. Einige wenige Medienhäuser erreichen große Teile der Bevölkerung und bestimmen somit auch, welcher Stellenwert genderspezifischen Themen zukommt. Umso wichtiger ist die Frage, inwieweit Frauen an der Produktion von Medieninhalten beteiligt sind (GMMP 2015).
FRAUEN, MEDIEN, ÖSTERREICH: EIN LAGEBERICHT
Ausgehend von der unzureichenden Informationslage und mit dem Wissen um strukturelle Geschlechterunterschiede in der Medienbranche starteten wir ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, die aktuelle Verteilung von Journalistinnen und Journalisten in Österreich zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen: Frauen sind im österreichischen Journalismus mit 47% fast gleich stark vertreten wie Männer mit 53%. Unter freien JournalistInnen sind dagegen 42% Frauen und 58% Männer. Dieses Ergebnis widerspricht der häufigen Annahme, Frauen seien häufiger als Freelancer beschäftigt; die Veränderung ist auf die allgemeine Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse in der Medienbranche zurückzuführen (Hummel und Kassel 2009).
Auf Führungsebene ist die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen allerdings immer noch immens. Während unter den angestellten RedakteurInnen Frauen (49%) und Männer (51%) mittlerweile gleich stark vertreten sind, sitzen in den Chefredaktionen nur 29% Frauen im Vergleich zu 71% Männern. Das Paradox: Frauen in der Medienbranche haben tendenziell höhere Bildungsabschlüsse und bilden die Mehrheit der AbsolventInnen medienrelevanter Studiengänge (Dorer et al. 2009), trotzdem steigen sie nachweislich seltener in Entscheidungspositionen auf als ihre männlichen Kollegen. Diese gläserne Decke hat hauptsächlich strukturelle und gesellschaftliche Gründe. Darunter sind vor allem die Unvereinbarkeit des Berufs mit der Familie sowie eine männlich dominierte Unternehmenskultur, zu der Frauen schwer Zugang finden (Kirchhoff und Prandner 2016).
DIE METHODE
Im Laufe unserer quantitativen Studie lernten wir schnell, auch die Grenzen unserer Forschungsmöglichkeiten zu akzeptieren. So mussten wir uns beispielsweise früh von der Vorstellung verabschieden, eine mögliche Gender Pay Gap im Journalismus zu belegen, da dazu schwer Daten erhoben werden können.
Auch die Frage, wie es mit dem Interesse für Genderthemen an der Hochschule steht, wurde im Kontext unserer Lehrveranstaltung deutlich: In dem Proseminar mit dem Titel „Gender Mainstreaming“ befanden sich – zu niemandes Überraschung – ausschließlich Studentinnen. Es sind also durchaus weitere Bemühungen notwendig, um das Bewusstsein und Interesse am Thema „Gleichberechtigung“ unter – vor allem männlichen – Studierenden zu fördern.
WAS NUN?
Hier wären wir auch schon bei einer ersten Maßnahme, die es braucht, um die Gleichstellung in der Branche voranzutreiben: Es sollte in medienwissenschaftlichen Studiengängen mindestens eine verpflichtende Lehrveranstaltung zum Thema festgelegt werden. Bleiben Kurse zu Gleichberechtigung nur freiwillige Wahlfächer, werden sich weiterhin fast ausschließlich Menschen damit beschäftigen, die bereits Interesse und Vorwissen in diesem Bereich haben.
Doch eine bloße Sensibilisierung von Medienstudierenden wird kaum ausreichen, um die Bedingungen für Frauen strukturell zu verbessern und um das glass ceiling letztendlich zu beseitigen. Dazu braucht es Maßnahmen auf Policy-Ebene. Vor allem auf Führungsebene wird man um institutionalisierte Geschlechterquoten nicht herumkommen. Denn das vielfach bemühte Argument, Kompetenz würde – unabhängig vom Geschlecht – ohnehin zum Aufstieg auf der Karriereleiter führen, schlägt sich in den Zahlen keineswegs nieder.
Von JournalistInnen werden hohe Flexibilität und unregelmäßige Arbeitszeiten gefordert, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zweifellos erschwert. Dieser Zustand ist aber keineswegs „naturgegeben“, es fehlen schlicht die nötigen Strukturen zur gerechten Aufteilung der Erziehungspflichten. Der Unterschied kann auf gesellschaftlich immer noch fest verankerte Rollenbilder zurückgeführt werden, die nur langsam aufgebrochen werden. Umso wichtiger ist die Unterstützung arbeitender Mütter – sei es durch längere Karenzzeiten für Väter, firmeninterne Kinderbetreuung oder flexiblere Arbeitszeitmodelle.
FRAUEN FÜR FRAUEN
Können wir also optimistisch sein? Ja, denn es sind tatsächlich fast gleich viele Frauen wie Männer in den österreichischen Medien tätig. Ist die Arbeit somit getan? Auf keinen Fall, denn die gläserne Decke ist in der Branche nach wie vor fest verankert, wenn auch mit ein paar Sprüngen.
Es ist an uns zukünftigen Medienschaffenden, Frauen im journalistischen Tagesgeschäft eine starke Stimme zu geben. Das funktioniert am effektivsten, wenn Frauen Frauen unterstützen und sich gegenseitig als Expertinnen und Reporterinnen heranziehen. Und es ist an den KollegInnen im akademischen Betrieb, sich für verpflichtende Lehrveranstaltungen zum Thema „Gender und Medien“ einzusetzen und so zu sensibilisieren. Auch mir wurde erst durch dieses Projekt bewusst, wie sehr ich das Mantra “Eine Karriere im Journalismus ist unverträglich mit einer potentiellen Familie” verinnerlicht hatte. Wir müssen schon im Studium hinterfragen, woher diese Vorstellungen kommen und wie wir festgefahrene Arbeitsstrukturen aufbrechen können. Vor allem aber müssen wir uns trauen, Ungerechtigkeiten im Berufsalltag aktiv anzusprechen. Die gläserne Decke fällt so hoffentlich bald in sich zusammen.
QUELLEN
Dorer, J., Götzenbrucker, G.; Hummel, R. (2009): The Austrian journalism education landscape. In Terzis, G. (ed.): European Journalism Education. Bristol/ Chicago: Intellect, S. 79-92.
Hummel, R.; Kassel, S. (2009): Strukturdatenanalyse der Entwicklung des österreichischen Journalismus (1946–2008). In B. Stark and M. Magin (eds.): Die österreichische Medienlandschaft im Umbruch. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, S. 219-38.
Kamerick, M. (2011): Women should represent women in media. TedxABQ.
Kirchhoff, S.; Prandner, D. (2016): Austria – Working Conditions, Representation and Measures Towards Gender Equality. In Ross, K.; Padovani, C. (eds.): Gender Equality and the Media: A Challenge for Europe. New York: Routledge, S. 47-59.
Statistik Austria (5.3.2019): Gender-Statistik. Einkommen.
The Global Media Monitoring Project (2015): Who Makes the News? Austria National Report.
Bild: ©pexels.com