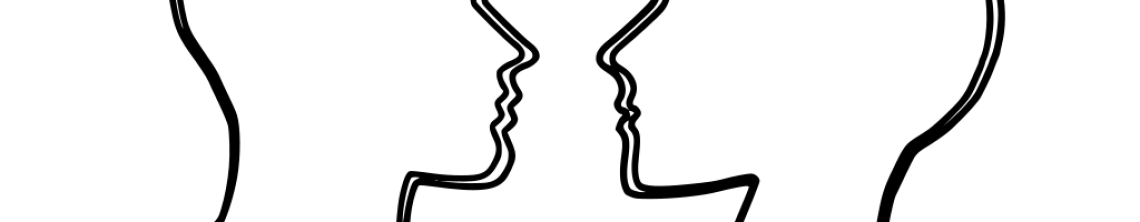Von Maryam Ghanem
Das Global Media Monitoring Project ist die größte internationale Studie, die alles rund um Gender in der medialen Berichterstattung untersucht. Dabei wurden etliche Ungleichheiten zwischen Mann und Frau statistisch festgehalten. So hat sich herausgestellt, dass sich durchschnittlich unter fünf interviewten ExpertInnen, unter vier „media decision-makers“, unter drei ReporterInnen eine Frau befindet. Letzteres ist seit zehn Jahren unverändert (GMMP 2015).
Auf den ersten Blick wirkt das Geschlechterverhältnis in der Medienbranche wegen der Vielzahl der weiblichen Mediensubjekte, wie etwa Moderatorinnen oder Reporterinnen, nicht allzu problematisch. Frauen haben in der österreichischen Medienlandschaft zunehmend Positionen, die vor der Kamera stattfinden, was den Eindruck erwecken kann, dass Frauen im Mediensektor genauso viele Arbeitsplätze besetzen wie Männer.
Dass Frauen unterrepräsentiert sind, steht außer Frage. Das Augenmerk sollte dabei nicht nur auf die Unterrepräsentation gerichtet sein, sondern auch auf die Scheinrepräsentation. Darunter kann man folgendes verstehen: Frauen sind in der österreichischen Medienlandschaft augenscheinlich – vor allem im Rundfunk – repräsentiert, dennoch gehört die Stimme tendenziell den Männern. Die Präsenz von Frauen vor der Kamera birgt die Gefahr, dass uns das Defizit der Frauen hinter der Kamera entgeht. Auch heute sind die Männer diejenigen, die mehrheitlich hochrangige Positionen einnehmen und wichtige Entscheidungen treffen. Allein im Jahr 2017 waren fast 70 Prozent der entscheidungstragenden Positionen von Männern besetzt (EIGE 2017). Zu diesen Positionen gehören organisatorische Stellen wie Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (COO) und Senior Manager.
Die Tatsache, dass viele ModeratorInnen und Reporterinnen Frauen sind, impliziert im Kontext mit dem Problem der Augenscheinlichkeit eine gewisse Objektivierung und Instrumentalisierung der Frau. Der Mann, der über Inhalt entscheidet, und die Frau, die diesen Inhalt hinunterliest bzw. vorträgt. Dass die frauenfreundlichsten Medienjobs vor der Kamera stattfinden, hat unter anderem audiovisuelle Gründe. Ganz primitiv gesehen, kann die Attraktivität einer Frau auf den Sender übertragen werden und so ZuschauerInnen anlocken. Zudem haben Frauenstimmen eine besondere Klangfarbe. Nachgewiesenermaßen wirkt die Stimmfarbe einer Frau trivial, expressiv und emotional, während die eines Mannes Objektivität ausstrahlt (Celikkol 2011: 273f). Aus diesem Grund werden ernstere Themen, wie Politik und Wirtschaft, vor der Kamera eher von Männern behandelt. Frauen hingegen berichten oft über Kriminalfälle und Promiklatsch (GMMP 2015).
Wieso ist nicht nur die visuelle Repräsentation, sondern auch und vor allem die Mitwirkung hinter den Kulissen wichtig? Nun, wie viele KommunikationswissenschaftlerInnen bereits festgestellt haben, bilden die Medien die vierte Gewalt der Gesellschaft, weil sie die öffentliche Meinung maßgeblich formen, oder in manchen Fällen auch erst schaffen. Medien waren sehr lange männerdominiert. Das wurde besonders dann deutlich, als Frauen editorische Stellen übernommen haben, und der Fokus auf bad news als traditioneller Nachrichtenwert abgenommen hat (GMMP 2015). Entscheidungen, die innerhalb eines Medienkonzerns getroffen werden, wirken sich nicht nur auf die Organisation selbst aus, sondern ebenso auf die Gesellschaft. Wenn der Inhalt der Berichterstattung also von Männern festgelegt wird, kann man davon ausgehen, dass die öffentliche Meinung „männerfreundlicher“ ist.
Im Rahmen des Gender-Mainstreaming-Konzepts können Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt werden. Was allerdings nie eine Lösung bei diesem Geschlechter-Dilemma sein kann, ist eine Quotenregelung, so wie sie beispielsweise im Parlament herrscht. Eine Frauenquote ist Männern und nicht-binären Geschlechtern gegenüber diskriminierend. Menschen müssen aufgrund ihrer Qualitäten eingestellt werden. Um das zu gewährleisten, können im Bewerbungsprozess Anpassungen unternommen werden, wie zum Beispiel die Maßnahme, soziodemografische und optische Merkmale auszublenden. Dies käme nicht nur Frauen und anderen Minderheiten zugute. Auch ArbeitgeberInnen werden eine Effizienzsteigerung feststellen, weil sie auf Können gesetzt haben und nicht auf Oberflächlichkeiten. Ein grundlegender Punkt, der das Berufsleben vieler Frauen beeinflusst, ist das Muttersein. Arbeitende Frauen sind häufig auf Teilzeit-Basis angestellt, um Familie und Haushalt pflegen zu können. Deswegen ist auch nur ein Drittel aller Vollzeit-JournalistInnen weiblich (IWMF 2011). Da gibt es so einiges, das gemacht werden kann, um Frauen zu fördern: Zum einen können Kinderstätten am Arbeitsplatz errichtet werden. Das Aufteilen der Karenz kann man attraktiver gestalten, damit sich Mutter und Vater abwechselnd um Kind und Arbeit kümmern können. Die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten, soll erweitert und gegebenenfalls auf Lebensumstände angepasst werden. Das Wichtigste hierbei ist, sukzessiv vorzugehen. Kleinere Schritte zu machen, um letztendlich Großes zu bewirken. Wenn ein Medienkonzern die nötigen Mittel hat, kann eine eigene Gleichstellungsabteilung eingerichtet werden, so wie es beim britischen Sender BBC mit ihrem Equal Opportunity Department der Fall ist.
Ich sehe unsere Aufgabe als angehende JournalistInnen und als BewohnerInnen dieser Erde darin, nicht nachzugeben und offensiv zu sein. Die Medien sollen genau so bunt sein wie unsere Welt. Es ist nicht genug, dass 30 Prozent aller ReporterInnen Frauen sind – wir wollen 50 Prozent. Es ist nicht genug, dass 30 Prozent aller Vollzeit-JournalistInnen weiblich sind – wir wollen 50 Prozent.
Ich kämpfe und stehe nicht nur für Frauen, ich kämpfe und stehe für Minderheiten. Mein Erscheinungsbild als muslimische Frau hat mir im Journalismus schon einige Türen geöffnet, aber mindestens die doppelte Anzahl dieser Türen verschlossen. Ich wünsche mir einen Journalismus, nein eine Gesellschaft, die den Menschen priorisiert, und nicht einzelne Merkmale. Ich wünsche mir einen Journalismus, den beide Geschlechter und alles dazwischen nachvollziehen können. Solange ich danach strebe, muss ich präsent sein. Ich muss mich in die Medienbranche einbringen, um sie von innen heraus zu verändern. Uns reichen keine 25 Prozent, die mitsprechen und die Gesellschaft mitgestalten dürfen – wir wollen 50 Prozent.
Bild: (c) Filip Mishevski via unsplash.com
Byerly C. M. (2011): Global Report on the Status Women in the News Media. Washington, DC: International Women’s Media Foundation [IWMF].
Celikkol, M. (2011): Frauen-und Männerstimmen in Medien. Moderatorinnen und Moderatoren in Rundfunk und Fernsehen. Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg.
EIGE (Gender Equality Index). (2017): „Methodological Report.“ Eurpean Institute for Gender Equality. 729. Jg., Nr. 2017.
GMMP (Global Media Monitoring Project). (2015). Who Makes the News?.